Die internationale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten.
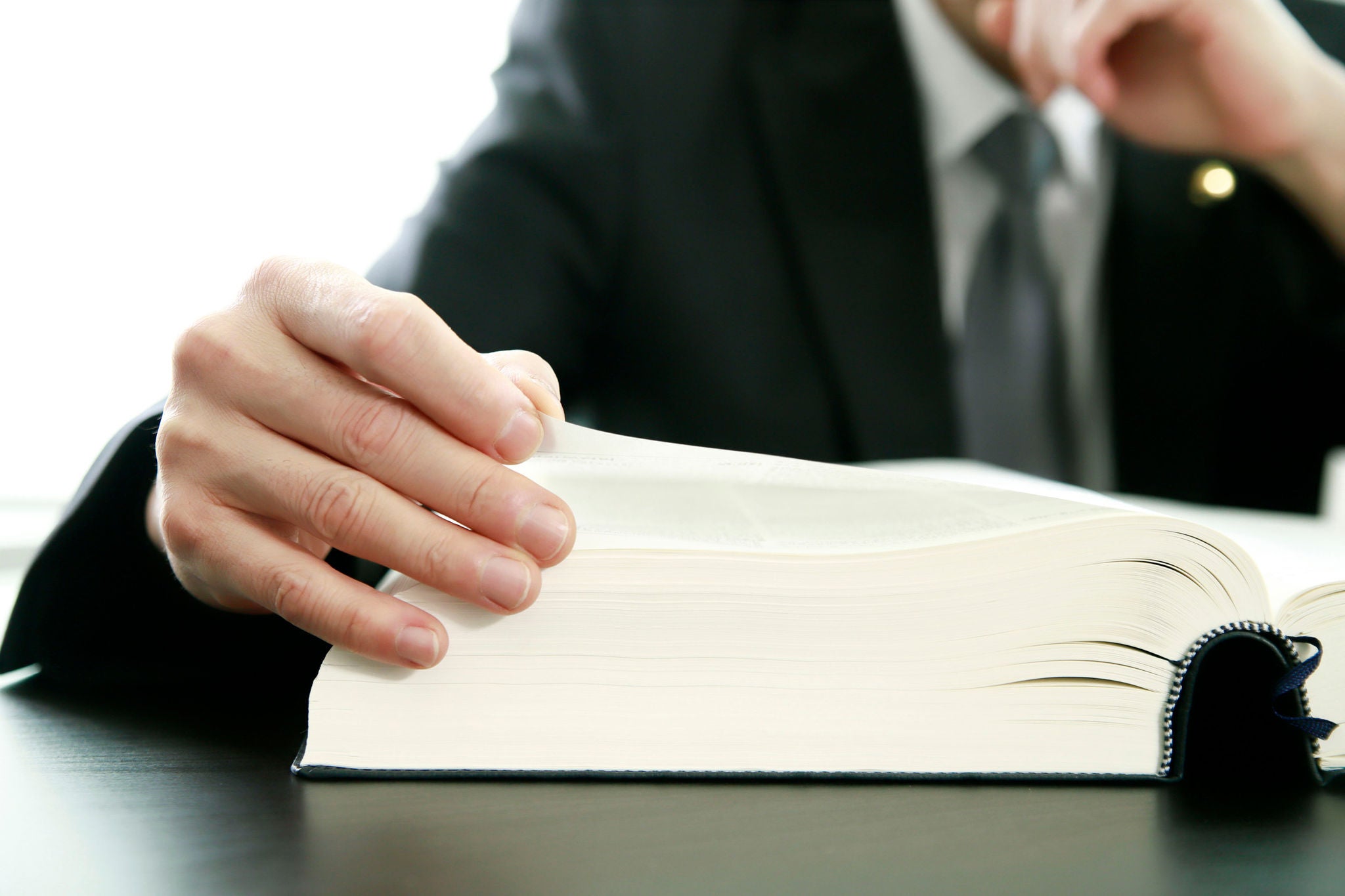
Der geschäftliche Verkehr ist geprägt von unterschiedlichen Vertragsverhältnissen, woraus eine Vielzahl von Verpflichtungen und Ansprüchen entsteht. Diese bestehen jedoch nicht unbegrenzt fort, sondern unterliegen zeitlichen Grenzen. Während das Wort „Verjährung“ grundsätzlich den meisten Teilnehmern im geschäftlichen Verkehr ein Begriff ist, herrscht regelmäßig Unsicherheit nicht nur darüber, wie lang die Verjährungsfrist ist, sondern noch viel mehr darüber, wann diese zu laufen beginnt und wann sie endet. Nicht überraschend sind diese Fragen deshalb auch regelmäßig Gegenstand von Gerichtsentscheidungen.
Hintergrund und Grundsätze der Verjährung
Regelverjährung
Für Ansprüche, deren Verjährung nicht speziellen Sonderverjährungsregeln unterliegen, gilt die Regelverjährung von drei Jahren gemäß §§ 195, 199 BGB. Diese Regelverjährung beginnt gemäß § 199 Abs. 1 BGB mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangte oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Zum Verjährungsbeginn hatte der BGH jüngst in seinem Urteil vom 15.03.2024 – Az.: V ZR 224/22 – eine wichtige Klarstellung zu seiner früheren Rechtsprechung getroffen: Für den Beginn der Verjährungsfrist für Ansprüche aus einem gegenseitigen Vertragsverhältnis reicht nicht schon der Vertragsabschluss, sondern es bedarf zusätzlich der Fälligkeit des jeweiligen Anspruchs, wenn dieser wegen einer von vornherein getroffenen vertraglichen Abrede erst zu einem späteren Zeitpunkt fällig wird.
So wird der kaufvertragliche Übereignungsanspruch eines Grundstücks (wie in dem vom BGH zu beurteilenden Fall) regelmäßig nicht direkt mit Vertragsschluss fällig. Der Verkäufer hat ein schützenswertes Interesse daran, erst nach Erhalt des Kaufpreises das Eigentum an seinem Grundstück zu übertragen. Daher werden in einem Grundstückskaufvertrag üblicherweise abweichende Regelungen zur Fälligkeit des Anspruchs auf Eigentumsverschaffung getroffen. Solche Regelungen zur Sicherung des Verkäufers können dazu führen, dass der Anspruch auf Eigentumsverschaffung erst mit dem Nachweis der Kaufpreiszahlung fällig wird. Ist die Fälligkeit des Anspruchs also vertraglich an eine Handlung des Gläubigers, wie z. B. die Erstellung einer Abrechnung, gebunden oder haben die Parteien vereinbart, dass „Zahlung gegen Dokumente“ erfolgen soll, so beginnt die Verjährungsfrist nicht zu laufen, bis diese Handlung vorgenommen wurde.
Ausnahmen – Sonderverjährungsregelungen
Für bestimmte Verträge bzw. Anspruchsarten gelten nicht nur andere Verjährungsfristen als die dreijährige Regelverjährung, sondern auch der Fristbeginn bestimmt sich anders. Hierzu existieren zahlreiche Sondervorschriften.
So gilt u. a. für Schadensersatzansprüche wegen vorsätzlicher Verletzung der körperlichen Integrität, für Herausgabeansprüche aus dinglichen Rechten oder für titulierte und gleichgestellte Ansprüche sogar eine 30-jährige Verjährungsfrist. Ist man also z. B. Eigentümer einer Sache und hat einen gesetzlichen Herausgabeanspruch nach § 985 BGB gegen den unrechtmäßigen Besitzer, so unterliegt der dahinterstehende Herausgabeanspruch der 30-jährigen Verjährungsfrist, um das Eigentum in besonderer Weise zu schützen. Gleiches gilt z. B. auch bei Ansprüchen, die rechtskräftig durch ein Urteil oder einen Vollstreckungsbescheid festgesetzt wurden. Der Verjährungsbeginn wird hier jeweils an unterschiedliche Ereignisse geknüpft (an die Begehung der Handlung bzw. der Pflichtverletzung oder an ein sonstiges schadensauslösendes Ereignis, an die Entstehung des Anspruchs oder an die Rechtskraft der Entscheidung etc.), sodass Ansprüche unter Umständen viele Jahrzehnte nicht verjähren.
Die wohl bekannteste Sonderverjährungsregel ist die nur zweijährige Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus Kauf- und Werkverträgen (§§ 438, 634a BGB), die im Volksmund auch oft fälschlicherweise als „Garantiezeitraum“ bezeichnet wird.
Auch hier unterscheidet sich der Verjährungsbeginn von der Regelverjährung: Während die Verjährung beim Werkvertrag grundsätzlich mit Abnahme des Werkes beginnt, startet diese bei Kaufverträgen regelmäßig mit Übergabe bzw. Ablieferung der Kaufsache beim Käufer, da dieser ab diesem Zeitpunkt die Verfügungsgewalt über die Sache innehat. Werden etwaige Mängel der Kaufsache arglistig verschwiegen, findet wiederum die Regelverjährung Anwendung.
Für Mängelansprüche an Bauwerken gilt hingegen eine Verjährungsfrist von fünf Jahren, die mit Übergabe des Grundstücks beginnt.
Hemmung und Neubeginn der Verjährung
Hat die Verjährung einmal zu laufen begonnen, kann sie grundsätzlich auch durch verschiedene Tatbestände gehemmt, also unterbrochen werden, u. a. durch Rechtsverfolgungsmaßnahmen wie z. B. die Zustellung eines Mahnbescheids, der Klageerhebung, der Streitverkündung oder der Anmeldung eines Anspruchs im Insolvenzverfahren (vgl. § 204 Abs. 1 Nr. 1–14 BGB), aber z. B. auch durch Verhandlungen über den Anspruch (§ 203 BGB). Fällt das hemmende (unterbrechende) Ereignis weg, läuft die restliche Verjährungsfrist wieder weiter, ohne dass der Zeitraum der Unterbrechung eingerechnet wird. Besonderheiten ergeben sich jedoch bei Einleitung von Vollstreckungsmaßnahmen, denn diese lösen den Neubeginn der Verjährung aus. Gleiches gilt, wenn der Schuldner gegenüber dem Gläubiger den Anspruch durch Abschlagszahlungen, Sicherheitsleistungen oder Zinszahlungen anerkennt. Im Gegensatz zur Hemmung ist bei einem Neubeginn die zuvor bereits verstrichene Verjährungsfrist nicht mehr relevant. Mit dem jeweiligen Ereignis beginnt die Verjährung völlig neu zu laufen.
Zudem finden sich zahlreiche weitere Tatbestände, die den Ablauf der Verjährung hemmen, z. B. im Rahmen von zwischen Unternehmern und Verbrauchern geschlossenen Verträgen, insbesondere wenn die Ware sog. digitale Elemente enthält (§ 475e BGB). Hierbei kann die Ware wie beispielsweise eine Smartwatch oder ein Smartphone ohne das digitale Element ihre Funktionen nicht erfüllen. Beim Kauf von Waren mit digitalen Elementen endet für Mängel an dauerhaft bereitzustellenden digitalen Elementen die Verjährung nicht vor Ablauf von zwölf Monaten nach Ende des Bereitstellungszeitraums. Ansprüche wegen einer Verletzung der Aktualisierungspflicht verjähren nicht vor dem Ablauf von zwölf Monaten nach Ende der Aktualisierungspflicht.
Fazit
Das Verständnis der Verjährungsgrundsätze ist maßgeblich, um sich erfolgreich gegen Ansprüche verteidigen zu können oder eigene Ansprüche durchzusetzen. Die allgemeine Regelverjährung von drei Jahren setzt nicht mit dem Vertragsschluss ein, sondern erst mit dem Jahresende, in dem der Anspruch entstanden ist und dem Gläubiger bekannt wurde. Sonderregelungen mit variierenden Fristen und unterschiedlichem Fristenbeginn bestehen für spezifische Anspruchstypen. Zudem kann die Verjährung durch bestimmte Ereignisse gehemmt oder neu ausgelöst werden, was den Ablauf der Fristen wiederum verzögert. Im Ergebnis können Ansprüche daher, obwohl in rein zeitlicher Hinsicht die Fristen schon längst abgelaufen zu sein scheinen, noch lange nicht verjährt sein. Hier empfiehlt sich eine genaue Prüfung, ob es sinnvoll ist, als Schuldner eines Anspruchs die Einrede der Verjährung zu erheben bzw. als Gläubiger auf die Erfüllung zu bestehen oder Maßnahmen zur Hemmung der Verjährung herbeizuführen. Bei bekannten Verjährungsfristen sollte ein aktives Monitoring (z. B. über ein Vertragsmanagementsystem) erfolgen, um nicht in die Verjährungsfalle zu tappen.
Kontaktperson: Tanja Reinhoffer
Direkt in Ihr E-Mail Postfach
Wir informieren Sie monatlich über aktuelle Themen insbesondere aus den Bereichen Arbeitsrecht, M&A, Gesellschaftsrecht, PE, Kartellrecht, Energierecht, Digital Law, Public Law, Public Mobility Law und Legal Process and Technology. Wenn Sie an unserem Newsletter und dem Law Quarterly Webcast interessiert sind, können Sie sich hier anmelden.



